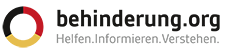Früherkennung von Hörschäden
Armin Löwe beschreibt in seinem Buch "Früherfassung, Früherkennung, Früherziehung hörgeschädigter Kinder"1 vier Wege zur Früherkennung von Hörschäden:
1. Früherkennung durch Verhaltensbeobachtung
Sehr hilfreich bei der Früherkennung durch Verhaltensbeobachtung sind die akustischen Verhaltensmerkmale von Säuglingen und Kleinkindern im Alter von 0-24 Monaten (nach Downs):
Akustisches Verhalten von Säuglingen
| Alter | 1. Reaktion auf reine Töne | Zu erwartende Reaktionen |
|---|---|---|
| 0-6 Wochen | bei 78 dB (Variationsbreite 72/84 dB) | Augenblinzeln, Moro-Reflex, Augenbewegen oder langsames Öffnen der Augen |
| 6 Wo. - 4 Monate | bei 70 dB (60/80 dB) | Augenblinzeln, Beruhigen, rudimentäre Kopfbewegungen |
| 4-7 Monate | bei 51 dB (40/60 dB) | Lauschen, Kopfbewegungen auf seitlicher Ebene, beginnende Lokalisation seitlich tiefer liegender Schallreize |
| 7-9 Monate | bei 45 dB (30/60 dB) | direkte Lokalisation von Schallreizen auf seitlicher Ebene und darunter |
| 9-13 Monate | bei 38 dB (20/50 dB) | direkte Lokalisation von Schallreizen auf allen Ebenen |
| 13-16 Monate | bei 32 dB (22/42 dB) | direkte Lokalisation von Schallreizen auf allen Ebenen |
| 16-21 Monate | bei 25 dB (15/35 dB) | direkte Lokalisation von Schallreizen auf allen Ebenen |
| 21-24 Monate | bei 26 dB (16/36 dB) | direkte Lokalisation von Schallreizen auf allen Ebenen |
Weiterhin ist das Wissen über die vorsprachliche Entwicklung sowie das erste Sprechen bei Kindern ohne Hörauffälligkeit sehr nützlich. Alle Säuglinge schreien und lallen im frühen Säuglingsalter. Ist der Säugling etwa 6 Monate alt, lernt er, daß er derjenige ist, der da lallt und schreit un beginnt bewußt mit seiner Stimme und mit vielen verschiedenen Konsonant- Vokal- Konsonant- Verbindungen zu experimentieren. Sollte er jedoch hochgradig hörgeschädigt sein, kann er sein eigenes Schreien nicht wahrnehmen und seine stimmlichen Äußerungen werden immer seltener werden. Darum ist das Versiegen oder weitgehende Fehlen des bewußten Stimmgebrauchs nach Vollendung des ersten Lebensjahres ein wichtiger Hinweis auf das Vorliegen einer Hörbeeinträchtigung. Auch eine weitere Abweichung in der sprachlichen Entwicklung (vgl. dazu die Kindheitsentwicklung ohne gesundheitliche Beeinträchtigung) kann durch eine mangelhafte Hörfähigkeit verursacht werden.
Sie möchten Ihr hörgeschädigtes Kind spielerisch fördern? Wir empfehlen Ihnen hierzu folgende Literatur
 Hörgeschädigte Kinder spielerisch fördern: Ein Elternbuch zum frühen Hör- und Spracherwerb (Batliner, 2013)
Hörgeschädigte Kinder spielerisch fördern: Ein Elternbuch zum frühen Hör- und Spracherwerb (Batliner, 2013)Es werden praktische Übungen und Spielsituationen geboten, die Eltern helfen, Ihr Kind mit Hörschädigung im Alltag gezielt zu fördern.
2. Früherkennung durch Untersuchung aller Neugeborenen
Keines der bereits entwickelten Verfahren zu einer Aussonderungsuntersuchung (Screening Test of Hearing) eignet sich für eine routinemäßige Überprüfung der Hörreaktion bei allen Neugeborenen. Trotzdem sollten solche Untersuchungen auch weiterhin durchgeführt werden.
3. Früherkennung durch Untersuchung aller audiologischen Risikokinder
Ob Neugeborene Risikokinder sind, läßt sich sowohl durch vor-, als auch nachgeburtliche Untersuchungen feststellen. Hierbei sind vorrangig folgende Kinder gemeint:
- Apgar unter 3
- Bilirubin im Serum über 20 mg%
- Congenitale Mißbildungen
- Drängen der Eltern wegen Verdacht
- Embryonale Infektionen und Intoxikationen (Medikamente, Nikotin, Alkohol, Rauschgift)
- Familiäre Belastung
- Geburtsgewicht unter 1500 g
- Hypoxie während der Schwangerschaft und Geburt
- Infektionskrankheiten in den ersten Lebensmonaten (z.B. Meningitis, Enzephalitis, schwere Viruserkrankungen) und Schädeltraumen
Die Untersuchungen sollten möglichst schon während der ersten Entbindungstage, noch vor ihrer Entlassung aus der Klinik und im ersten Lebensjahr vierteljährlich erfolgen. Nur so können progrediente Hörschäden rechtzeitig erfaßt und noch optimal gefördert werden.
4. Früherkennung durch Untersuchung aller Säuglinge im Alter von etwa sieben Monaten
Obwohl für Neugeborene noch kein zuverlässiges, schnell und leicht durchführbares Verfahren vorhanden ist, gibt es bei Säuglingen im siebten Lebensmonat bereits solche Verfahren. Dies gilt sowohl für diagnostische Tests, als auch für Aussonderungsuntersuchungen.
Diagnostische Tests untersuchen eine vorgefundene Hörbeeinträchtigung nach Art, Grad und Lokalisation möglichst umfassend.
Aussonderungsuntersuchungen erlauben lediglich eine Grobunterscheidung zwischen normaler Hörfähigkeit und Hörauffälligkeit.